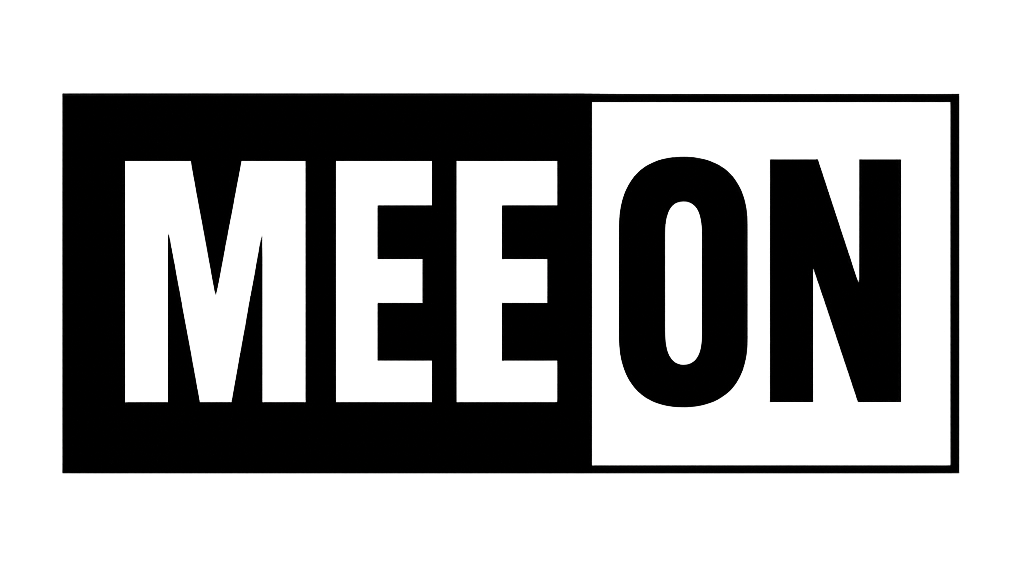Während Politiker mehr Arbeit fordern, kämpfen viele längst mit dem psychischen Kollaps. Wie viel Erschöpfung kann sich eine Gesellschaft leisten?
Einleitung: Die große Müdigkeit
Wir sind müde. Nicht einfach nur ein bisschen erschöpft, sondern grundlegend überreizt. Und doch läuft das System weiter – als wäre alles normal. Während Politiker nach mehr Arbeitszeit rufen, stemmen Millionen Menschen bereits das Maximum dessen, was sie psychisch noch tragen können. Nur spricht kaum jemand offen darüber.
Die neue Realität ist paradox: Wir leben in einer Zeit der Effizienz, der Tools, der Automatisierung – und dennoch scheint Arbeit immer mehr Raum zu fressen. Was ist passiert? Und vor allem: Wie kommen wir da wieder raus?
Was uns heute erschöpft – und warum es kaum auffällt
Psychische Erschöpfung hat viele Gesichter: Schlafstörungen, Reizbarkeit, Antriebslosigkeit, emotionale Taubheit. Das Problem: Diese Symptome passen erstaunlich gut in ein System, das reibungslose Funktion bevorzugt. Wer still leidet, stört nicht.
Ein entscheidender Begriff in der heutigen Arbeitswelt lautet Entgrenzung – die Auflösung klarer Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Möglich wurde sie durch digitale Technologien. Was 2005 noch ein Ausnahmefall war, ist heute Standard: E-Mails nach Feierabend, Deadlines am Wochenende, Projektstress im Urlaub. Wer sich abkoppelt, gilt schnell als unzuverlässig.
Die digitale Infrastruktur hat nicht nur Kommunikationswege beschleunigt, sondern auch die Erwartungen an individuelle Reaktionsgeschwindigkeit erhöht – psychologisch gesehen ein permanenter Alarmzustand.
Zwanzig Jahre Veränderung – und ein kollektiver Kraftverlust
Blicken wir zurück auf die letzten zwei Jahrzehnte, zeigt sich: Die Anforderungen an Erwerbstätige sind kontinuierlich gestiegen. Gründe dafür sind u. a.:
- Smartphones (seit 2007): permanenter Zugang zur Arbeit, auch außerhalb des Büros.
- Plattformökonomie: Arbeitsmodelle ohne klassische Sicherheiten – etwa bei Lieferdiensten oder Gig-Plattformen.
- Automatisierung und KI: der Druck, sich ständig weiterzubilden, um „nicht abgehängt“ zu werden.
Plattformökonomie, zur Erklärung: ein Wirtschaftsmodell, bei dem digitale Plattformen Arbeitsleistungen vermitteln (z. B. Uber, Lieferando, Fiverr), aber kaum Verantwortung für die Beschäftigten übernehmen.
Dazu kommt eine psychologisch brisante Erzählung, die besonders durch soziale Medien befeuert wird: „Hustle Culture“ – also die Vorstellung, dass ständige Selbstoptimierung, Produktivität und Leistung nicht nur notwendig, sondern identitätsstiftend sind. Wer nichts leistet, „verliert“.
Zäsur Covid – und was geblieben ist
Die Pandemie war ein Schockmoment. Für viele wurde sie zur radikalen Entschleunigung – aber auch zur Dauerbelastung, insbesondere für Eltern, Pflegekräfte und prekär Beschäftigte. Homeoffice etablierte sich über Nacht, Care-Arbeit wurde ins Private verlagert.
Doch was blieb, ist keine neue Balance, sondern eine Verdichtung: Work from home wurde oft zu work all the time. Die körperliche Distanz zum Büro wurde ersetzt durch emotionale Nähe zur Deadline.
Gleichzeitig schlich sich eine weitere Erzählung ein: Wer „dankbar“ ist, überhaupt noch arbeiten zu können, solle bitte nicht klagen. Psychische Belastung wurde individualisiert – als persönliches Defizit, nicht als strukturelles Problem.
Politische Rhetorik: Mehr Arbeit = mehr Wohlstand?
Während immer mehr Menschen mit psychischer Dauerüberlastung kämpfen, fordern führende Stimmen aus Politik und Wirtschaft das Gegenteil:
- Christian Lindner (FDP): „Wir müssen arbeiten, statt träumen.“
- Jens Spahn (CDU): „Vier-Tage-Woche ist eine Illusion.“
- Rainer Dulger (Arbeitgeberpräsident): „Wir haben ein Mentalitätsproblem in Deutschland. Wir müssen wieder mehr leisten wollen.“
Solche Aussagen blenden die Realität vieler Beschäftigter aus – oder werten sie sogar ab. Die Botschaft: Du bist selbst schuld, wenn du nicht mehr kannst. Dabei zeigt jede Statistik: Psychische Erkrankungen sind seit Jahren auf dem Vormarsch, mit Burnout und Depressionen ganz vorne.
Psychologie im Alarmzustand
Die aktuelle Lage zeigt: Unser psychisches Immunsystem ist überfordert. Therapien sind gefragt wie nie, doch Wartezeiten auf Plätze betragen mitunter 6–12 Monate. Das System kommt nicht hinterher.
Ein zentrales Problem ist, dass sich psychische Erschöpfung oft schleichend entwickelt – und gesellschaftlich akzeptiert ist. Wer gereizt, müde, fahrig ist, gilt nicht als krank, sondern als „normal gestresst“. Das ist brandgefährlich.
Begriff erklärt: Quiet Quitting
„Quiet Quitting“ beschreibt das bewusste Zurückfahren der eigenen Arbeitsleistung auf das vertraglich vereinbarte Minimum – als stiller Protest gegen Überforderung. Es geht nicht um Faulheit, sondern um Selbstschutz.
Diese Haltung zeigt: Viele Menschen haben kein Energieproblem, sondern ein Sinnproblem. Die Identifikation mit der Arbeit schwindet – und damit die Bereitschaft, sich für ein System aufzuopfern, das als kalt und ausbeuterisch empfunden wird.
Ein neues Verhältnis zur Arbeit: Aber wie?
Was wäre die Alternative zum aktuellen Dauerfeuer? Einige Ideen:
- Arbeitszeitverkürzung: Studien aus Island, Spanien und Großbritannien zeigen, dass 4-Tage-Wochen bei gleichem Lohn machbar sind – ohne Produktivitätseinbruch.
- Psychische Grundversorgung stärken: Mehr Therapieplätze, niedrigschwellige Angebote, betriebliche Resilienz-Trainings.
- Sinn-Orientierung statt Gewinnmaximierung: Unternehmen, die Werte ernst nehmen, gewinnen Mitarbeitende nicht nur – sie halten sie auch.
Und auf individueller Ebene?
- Digitaler Selbstschutz: klare Grenzen für Erreichbarkeit.
- Stille Sabotage von Überforderung: bewusstes Nein-Sagen.
- Austausch statt Rückzug: Über Erschöpfung zu sprechen, entstigmatisiert – und entlastet.
Was, wenn psychische Gesundheit kein Bonus mehr ist, sondern die Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit? Was, wenn wir nicht härter, sondern klüger arbeiten müssten – als Gesellschaft?
Reden wir darüber. Offen. Politisch. Persönlich.
Quelle: MEEON #24
Titel: Wer still leidet, stört nicht.
Bilder: MEEON