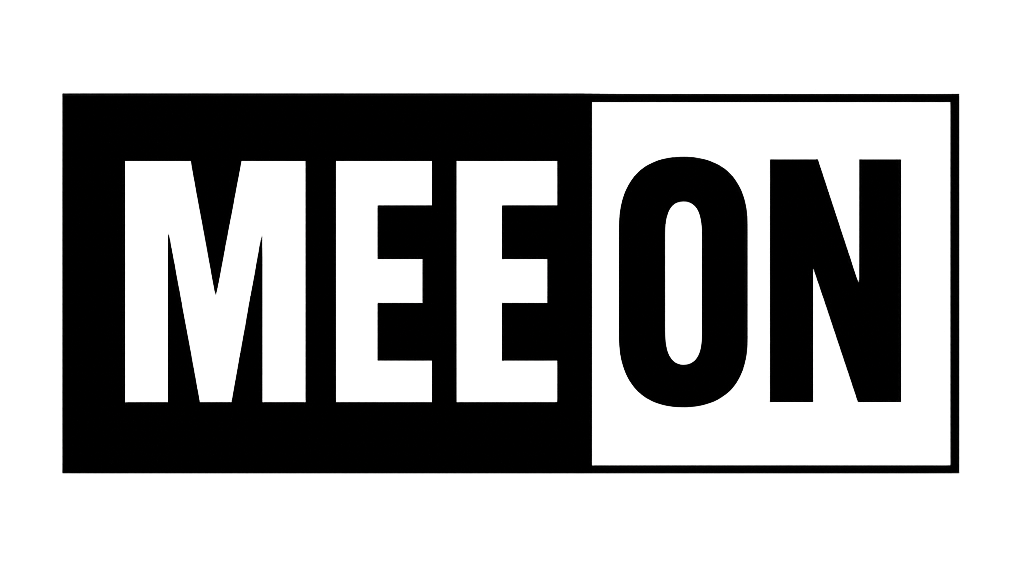True Crime zum Einschlafen. Trauma auf TikTok. Depression als Deep Talk.
Was als Aufklärung beginnt, endet oft als Trigger. Medien spielen mit psychischen Themen – und viele Nutzerinnen und Nutzer zahlen den Preis.
Scrollst du noch – oder zitterst du schon?
Wer sich durch Reels, Reportagen oder Reality-Formate klickt, stößt schnell auf Begriffe wie „Trauma“, „Angststörung“ oder „toxische Familie“. Mal als Clip mit Triggerwarnung, mal als Voyeur-Content ohne jede Einordnung. Und manchmal mitten im Feed, ohne Vorwarnung – während du eigentlich nur kurz abschalten wolltest. Willkommen in der Medienrealität von 2025: emotionalisiert, entgrenzt, betriebsbereit.
Aber was macht das mit Menschen, die wirklich betroffen sind?
Was passiert, wenn Medien psychische Krisen dramatisieren, romantisieren oder verkürzen – im Namen der Aufmerksamkeit? Und was, wenn sie das tun, ohne jede Kompetenz?
Wenn Ahnungslosigkeit auf Reichweite trifft
Das eigentliche Problem ist nicht, dass über Trauma, Depression oder Suizid gesprochen wird. Das Problem ist werdarüber spricht – und wie.
Talkshows laden „Betroffene“ ein, die ein spektakuläres Schicksal präsentieren, aber keine reflektierte Sprache dafür haben. TikTok-Influencerinnen teilen „10 Anzeichen für ein Trauma“, basierend auf vagen Buzzwords. Und selbsternannte Coaches versprechen Heilung – ohne therapeutische Ausbildung, aber mit Affiliate-Link.
Inkompetenz wird zur Meinung, Meinung zur Bühne.
Psychische Erkrankungen sind kein Unterhaltungsthema. Aber sie werden behandelt wie Diättipps oder Fashion-Trends. Jeder darf mitreden, jede darf deuten – Hauptsache, es klickt.
Das hat Folgen. Für die öffentliche Wahrnehmung. Für die Betroffenen. Für die, die gerade nicht stabil sind und mitansehen müssen, wie ihre Realität zum Content wird.
Triggerwarnung oder Triggerstrategie?
Triggerwarnungen sollen schützen. Aber immer häufiger wirken sie wie ein strategischer Köder:
„Triggerwarnung: Es wird emotional.“
„TW: Trauma, Suizidgedanken, toxische Familie.“
Was folgt, ist oft kein sensibler Umgang, sondern emotionalisiertes Clickbaiting. Die Warnung ersetzt die Verantwortung – und wird zur Legitimation, alles sagen zu dürfen.
Die Plattformlogik verstärkt das.
Emotion = Reichweite. Reiz = Retention. Das gilt für Instagram, für YouTube, für Dokus im Abendprogramm. Auch öffentlich-rechtliche Formate machen längst Quote mit psychischer Ausnahme.
True Crime und das Leid echter Menschen
Ein eigenes Kapitel verdient das Genre True Crime. Was einst investigative Aufarbeitung war, ist heute in vielen Fällen: Unterhaltung auf dem Rücken von Traumata. Mordfälle werden dramatisiert, Täterprofile voyeuristisch ausgewalzt, Opfergeschichten verkürzt. Und mitten drin sitzen Hosts, die nie gelernt haben, was sekundäre Traumatisierung bedeutet – weder für sie selbst noch für ihr Publikum.
Die psychologische Fallhöhe verschwindet hinter dramaturgischen Mustern.
Was bleibt, ist ein dumpfes Gefühl: Warum fühle ich mich nach dieser Folge eigentlich leer, ängstlich, verwirrt?
Vielleicht, weil das, was da erzählt wurde, nie für dein Wohnzimmer gedacht war.
Mental Health auf TikTok – zwischen Mut und Missbrauch
Natürlich gibt es auch die anderen: Creatorinnen und Creatoren, die differenziert, reflektiert und hilfreich über psychische Gesundheit sprechen. Die zeigen, dass Offenheit möglich ist – ohne Schaustellung. Doch sie gehen oft unter zwischen den 15-Sekunden-Diagnosen und den weinenden Selfie-Clips, die mehr Selbstinszenierung als Selbsthilfe sind.
Das Problem ist nicht die Plattform – sondern die Beliebigkeit, mit der psychische Gesundheit dort behandelt wird.
„Ich glaube, ich habe ein Trauma“ – hunderttausendmal gesagt, oft ohne zu verstehen, was das bedeutet.
„Ich bin so depressiv“ – als Caption zu einem gut ausgeleuchteten Reel.
„Mein Therapeut sagt…“ – obwohl keiner besucht wurde.
Was entsteht, ist eine toxische Mischung aus Echtheit und Inszenierung, aus Enttabuisierung und Überforderung. Und dazwischen Menschen, die sich fragen: Gilt mein Leiden noch, wenn alle darüber sprechen?
Wo bleibt die Verantwortung?
Die Verantwortung liegt nicht nur bei den Plattformen oder Medienhäusern – sondern auch bei denen, die sich äußern.
Wer öffentlich über psychische Themen spricht, trägt mit, wie darüber gesprochen wird. Ob andere sich verstanden oder verhöhnt fühlen. Ob die Worte helfen oder schaden. Ob die Grenze zwischen Intimität und Öffentlichkeit gewahrt bleibt – oder nicht.
Inkompetenz ist keine Meinungsfreiheit.
Wenn Menschen über psychische Erkrankungen reden, ohne sie verstanden zu haben, richten sie Schaden an – auch wenn sie es gut meinen.
Und Medien, die solchen Stimmen Raum geben, ohne kritische Einordnung, sind Teil des Problems. Nicht Teil der Lösung.
Was wäre stattdessen möglich?
– Formate, die mit psychologisch geschulten Menschen erarbeitet werden
– Triggerwarnungen, die nicht nur auf Wirkung, sondern auf Kontext achten
– Creatorinnen und Creatoren, die sich ihrer Grenzen bewusst sind – und sie transparent machen
– Medienhäuser, die mentaler Gesundheit nicht als Story, sondern als Verantwortung begegnen
Es braucht einen neuen Standard. Einen, der psychische Themen weder verschweigt noch verwertet. Der versteht, dass Worte wirken – manchmal stärker als jede Szene.
Fazit: Reden ist nicht immer Hilfe
Es ist gut, dass mentale Gesundheit öffentlich diskutiert wird. Es ist richtig, dass Schweigen aufbricht. Aber es ist gefährlich, wenn das Reden zum Selbstzweck wird – und die Kompetenz fehlt.
Triggerwarnung: Realität – das heißt auch: Hinschauen, wer spricht. Wer zuhört. Und was das mit uns macht.
Denn was aufklärend gemeint ist, kann verletzen. Was helfen will, kann retraumatisieren. Und was echt wirkt, kann inszeniert sein.
Medien brauchen Kompetenz, nicht nur Content.
Und psychische Gesundheit verdient Respekt – nicht Reichweite.
Welche Inhalte zum Thema psychische Gesundheit empfindest du als hilfreich – welche als übergriffig? Teile deine Perspektive mit Menschen, denen dieses Thema wichtig ist. Und frage dich beim nächsten Scrollen: Hilft mir das gerade – oder triggert es mich?
Quelle: MEEON #84
Titel: Triggerwarnung: Realität
Foto: MEEON
Video: MEEON