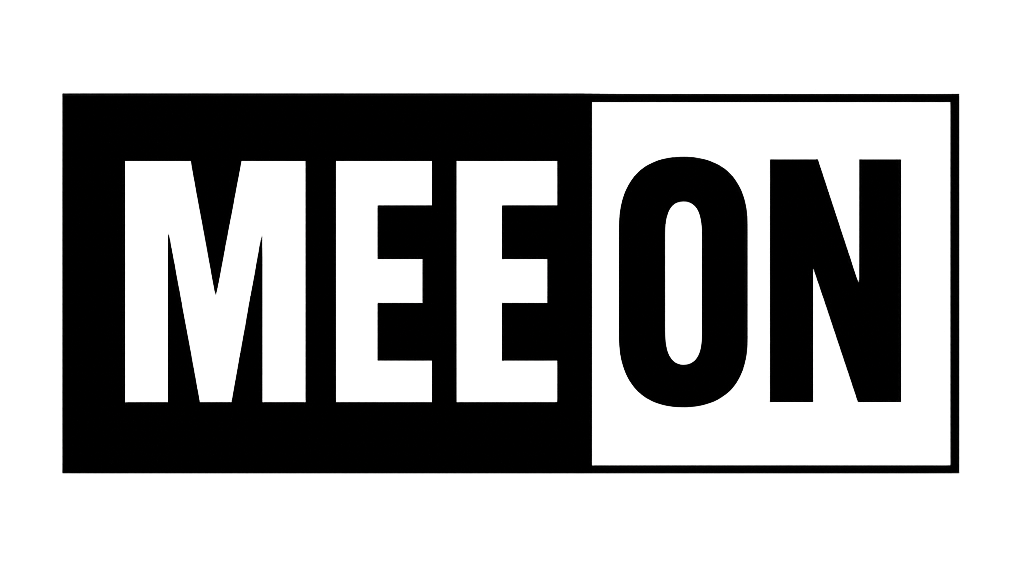Warum Trauma nicht in der Vergangenheit lebt, sondern im Körper – und wie Reinszenierungen unser Leben heimlich steuern.
Was wäre, wenn das Gefühl von Unsicherheit nicht „in deinem Kopf“ ist – sondern in deinem Nervensystem steckt? Was, wenn du Beziehungen sabotierst, dich sozial zurückziehst, dich immer wieder in toxischen Mustern wiederfindest – nicht, weil du es willst, sondern weil dein Körper es nicht anders kennt?
Willkommen in der Welt von Trauma und Reinszenierung. Es ist eine stille Realität für Millionen – oft unbemerkt, oft missverstanden. Dieser Artikel ist eine Einladung, das Thema nicht länger zu verdrängen.
Trauma: Kein Ereignis, sondern eine Reaktion
Psychologisches Trauma wird häufig mit Gewalt, Krieg oder Katastrophen assoziiert. Das greift zu kurz. Trauma ist nicht, was passiert – sondern was in einem Menschen als Reaktion passiert. Das Erleben von Bedrohung, Ohnmacht und Kontrollverlust kann tiefgreifende Spuren hinterlassen – selbst wenn das Umfeld glaubt: „So schlimm war das doch gar nicht.“
In der Psychotraumatologie wird klassisch unterschieden zwischen:
- Schocktrauma (einmalige, überwältigende Ereignisse wie Unfälle, Gewalt oder Naturkatastrophen)
- Entwicklungstrauma (anhaltende, frühe Erfahrungen von Unsicherheit, Bindungsstörungen, emotionaler Vernachlässigung)
- Bindungstrauma (Verletzungen innerhalb früher Bezugssysteme, insbesondere durch Bezugspersonen)
Gerade Bindungstraumata sind besonders tückisch: Sie wirken nicht durch das, was passiert ist – sondern durch das, was dauerhaft nicht passiert ist. Zuwendung, Resonanz, Sicherheit, Trost.
PTBS vs. CPTBS – was ist der Unterschied?
PTBS steht für Posttraumatische Belastungsstörung. Sie tritt auf, wenn ein einzelnes, überwältigendes Ereignis das Nervensystem in dauerhafte Alarmbereitschaft versetzt. Typisch sind Flashbacks, Vermeidung, Übererregung, Schlafstörungen, emotionale Taubheit.
CPTBS bedeutet Komplexe Posttraumatische Belastungsstörung – ein Begriff, der erst seit wenigen Jahren im ICD-11 (internationales Diagnosesystem) offiziell anerkannt ist. Sie entsteht meist durch langfristige, wiederholte traumatische Erfahrungen, oft in der Kindheit. Ihre Merkmale:
- Chronische Beziehungsprobleme
- Tiefgreifende Störungen im Selbstbild („Ich bin falsch, wertlos“)
- Starke Emotionsschwankungen
- Dissoziation (später mehr dazu)
Die CPTBS ist das psychologische Echo eines Lebens ohne sicheren Hafen.
Die Spur im Körper: Warum Trauma keine Erinnerung ist, sondern ein Zustand
Bessel van der Kolk, einer der international renommiertesten Traumaforscher, formuliert es eindrücklich: „Der Körper merkt sich, was der Kopf vergisst.“ In seinem Buch „Verkörperter Schrecken“ (Original: The Body Keeps the Score) erklärt er, dass Trauma vor allem eine körperliche Realität ist. Es verändert:
- das autonome Nervensystem (ständige Über- oder Untererregung)
- das Stresssystem (HPA-Achse): Kortisol, Adrenalin, ständige Alarmbereitschaft
- die Wahrnehmung von Zeit, Raum und Selbst (z. B. in Form von Dissoziation)
Traumatisierte Menschen befinden sich oft in einem biologisch begründeten Zustand von Gefahr, selbst wenn äußerlich alles ruhig ist. Das bedeutet: Die Vergangenheit ist nicht vorbei. Sie lebt – im Körper.
Dissoziation – Schutz durch Abspaltung
Ein zentraler Überlebensmechanismus bei Trauma ist Dissoziation. Das bedeutet nicht „verrückt sein“, sondern ein Abschalten von Bewusstsein, Emotion oder Körperempfindung. Es ist ein Schutzreflex: Wenn das Erleben zu schmerzhaft ist, trennt sich das Ich davon ab.
Dissoziation kann sich äußern durch:
- das Gefühl, „wie ferngesteuert“ zu funktionieren
- Zeitlücken oder Blackouts
- das Gefühl, sich selbst von außen zu beobachten
- emotionale Taubheit („Ich spüre nichts“)
- körperliche Entfremdung („Das bin nicht ich“)
Dissoziation ist keine Schwäche. Es ist ein intelligenter Selbstschutz – aber einer, der sich langfristig gegen die Betroffenen wenden kann.
Reinszenierung: Wenn sich Geschichte wiederholt
Warum suchen viele Menschen unbewusst Situationen, die sie verletzen? Warum geraten Betroffene von Kindheitstraumata in ähnliche Partnerschaften – mit denselben Mustern von Ablehnung, Kontrolle oder emotionaler Kälte?
Die Antwort liegt in der unbewussten Reinszenierung.
Reinszenierung bedeutet: Das Nervensystem wiederholt frühere Situationen, weil es keine andere „Skripterfahrung“ kennt. Das Ziel ist nicht Leid – sondern Kontrolle. Die Logik: „Diesmal werde ich es meistern.“ Doch das gelingt selten, weil das Nervensystem in alte Muster zurückfällt: Erstarrung, Überanpassung, Selbstaufgabe, Wut.
Psychodynamisch gesprochen: Der Mensch versucht, das Trauma neu zu inszenieren – in der Hoffnung, es umzuschreiben.
Van der Kolk beschreibt, wie selbst Kinder, die misshandelt wurden, sich später in Gefahrensituationen begeben – nicht aus Masochismus, sondern aus einem inneren Drang zur Wiederholung. Gabor Maté nennt es: „Das Vertraute fühlt sich sicherer an als das wirklich Gute.“
Polyvagal-Theorie: Das Nervensystem als soziale Landkarte
Ein wichtiger Erklärungsansatz stammt von Stephen Porges: die Polyvagal-Theorie. Sie beschreibt, wie unser autonomes Nervensystem (Sympathikus = Alarm, Parasympathikus = Ruhe) auf soziale Umwelt reagiert – nicht kognitiv, sondern reflexhaft.
Drei Zustände sind entscheidend:
- Soziale Verbundenheit (ventraler Vagus): Kontakt, Sicherheit, Mitgefühl
- Kampf/Flucht (Sympathikus): Gefahr, Aktivierung
- Erstarrung/Abschaltung (dorsaler Vagus): Rückzug, Dissoziation
Traumatisierte Menschen pendeln oft zwischen Alarm und Erstarrung, ohne in den Zustand sozialer Sicherheit zurückzufinden. Das erklärt viele Symptome: Schlafstörungen, Reizbarkeit, emotionale Abwesenheit, körperliche Spannungen.Wenn das Trauma den Alltag bestimmt – und niemand es sieht.
Viele Menschen, die unter den Folgen eines Traumas leiden, merken es lange selbst nicht. Sie gehen zur Arbeit, zahlen ihre Miete, pflegen Smalltalk. Sie funktionieren. Und genau das macht es so schwer: Traumafolgestörungen verstecken sich nicht selten hinter einem unauffälligen Leben.
Doch unter der Oberfläche kämpfen diese Menschen mit:
- Chronischer Anspannung (Hypervigilanz)
- Emotionaler Taubheit (Gefühlsabflachung)
- Bindungsängsten oder -sucht
- Ständigem inneren Alarm
- Selbsthass, Schuld oder Scham
- Selbstwertkrisen und depressiven Zuständen
Der Körper ist in Dauerbereitschaft. Beziehungen wirken bedrohlich. Vertrauen fühlt sich gefährlich an. Selbst Freude wird mit Vorsicht behandelt – zu groß scheint die Angst, sie könnte gleich wieder verschwinden.
Beziehung als Reinszenierungsraum
Ein zentraler Ort, an dem sich Trauma zeigt – und oft wiederholt –, sind zwischenmenschliche Beziehungen. Besonders Partnerbeziehungen und Freundschaften werden zum Schauplatz unbewusster Dynamiken. Zwei Beispiele:
1. Nähe als Bedrohung:
Ein Mensch mit Bindungstrauma kann sich nach Nähe sehnen und sie gleichzeitig als unerträglich erleben. Sobald jemand zu viel Interesse zeigt, geht der innere Alarm los. Rückzug, Abwertung oder Fluchtreaktionen folgen – nicht weil man nicht will, sondern weil das Nervensystem auf „Gefahr“ programmiert ist.
2. Kontrolle statt Verbindung:
Ein anderer Mensch versucht durch übermäßige Kontrolle oder Anpassung, Nähe „sicher“ zu machen. Man möchte alles richtig machen, immer verfügbar sein – aus Angst, verlassen zu werden. Doch diese Dynamik macht echte Intimität unmöglich.
Van der Kolk beschreibt diese Mechanismen als Reinszenierungen früher Ohnmachtserfahrungen. Es sind keine bewussten Entscheidungen, sondern tief verankerte Reaktionsmuster.
Gabor Maté: Krankheit als Sprache des Körpers
Der kanadische Arzt und Traumaexperte Gabor Maté geht einen Schritt weiter. In seinem Werk „Wenn der Körper nein sagt“ vertritt er die These, dass viele chronische Erkrankungen (z. B. Autoimmunerkrankungen, Krebs, Reizdarm) mit unterdrückten Emotionen und früheren Traumatisierungen zusammenhängen.
Sein zentrales Argument: Nicht das traumatische Ereignis selbst ist entscheidend, sondern wie das Kind es innerlich verarbeitet. Das heißt: Zwei Kinder können dieselbe objektive Situation erleben – aber nur eines entwickelt eine Traumafolgestörung, weil es keinen emotionalen Halt bekommt.
Typische Strategien traumatisierter Menschen – z. B. nie wütend sein, immer stark sein, sich selbst vergessen – führen langfristig zu innerem Stress, der sich körperlich niederschlägt. Gabor Maté sieht darin einen „leisen Selbstverrat“, den der Körper irgendwann nicht mehr tragen kann.
Warum Gesprächstherapie oft nicht reicht
Viele Menschen beginnen ihre therapeutische Reise in einer klassischen Gesprächstherapie. Das ist wichtig – aber oft nicht ausreichend. Warum?
Trauma ist nicht primär ein sprachliches Problem, sondern ein körperlich verankerter Zustand. Viele traumatisierte Menschen wissen kognitiv, dass sie heute sicher sind – aber ihr Körper reagiert weiterhin, als sei die Gefahr real.
Bessel van der Kolk nennt das die „Zweispurigkeit“ traumatischer Zustände: Verstand und Nervensystem sind nicht synchronisiert.
Deshalb braucht es körperorientierte Therapieverfahren, die nicht nur „reden“, sondern auch den Körper einbeziehen – dort, wo das Trauma gespeichert ist.
Körperorientierte Trauma-Therapien: Ein Überblick
1. EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing
EMDR ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode zur Verarbeitung traumatischer Erinnerungen. Sie wurde von Francine Shapiro entwickelt und basiert auf der Idee, dass bilaterale Stimulation (z. B. geführte Augenbewegungen) das Gehirn unterstützt, belastende Erfahrungen neu zu verarbeiten.
Der Ablauf:
- Die Patientin oder der Patient erinnert sich an das Trauma.
- Gleichzeitig folgt sie mit den Augen einer Handbewegung der Therapeutin.
- Die Erinnerung verändert sich – sie wird entschärft, der emotionale Schmerz reduziert sich.
EMDR kann in wenigen Sitzungen zu tiefgreifenden Veränderungen führen, vor allem bei Schocktrauma. Bei komplexen Traumata braucht es aber Vorbereitung, Stabilisierung und Erfahrung.
2. SE – Somatic Experiencing
Entwickelt von Peter Levine, basiert SE auf der Beobachtung, dass Tiere in der Wildnis nach Schreckreaktionen zittern oder sich ausschütteln, um den Stress zu entladen. Menschen hingegen unterdrücken diese Impulse – und halten das Trauma im Körper fest.
SE hilft:
- Körperreaktionen wieder bewusst wahrzunehmen
- Spannungen zu lösen, ohne retraumatisiert zu werden
- die natürliche Selbstregulation des Nervensystems zu reaktivieren
Die Arbeit erfolgt achtsam, langsam und ohne Druck. Ziel ist nicht das „Erinnern“, sondern das Lösen der eingefrorenen Reaktion.
3. IFS – Internal Family Systems
IFS geht davon aus, dass die menschliche Psyche aus verschiedenen Anteilen besteht. Manche Anteile tragen das Trauma („verletzte Kindanteile“), andere versuchen, es zu kontrollieren oder zu vermeiden („Manager“ oder „Feuerlöscher“).
Die Methode:
- hilft, innere Anteile zu erkennen und zu benennen
- fördert die Kommunikation zwischen ihnen
- ermöglicht, verletzte Anteile sicher zu integrieren
IFS ist besonders wirksam bei komplexen Traumata, bei denen klassische Gesprächstherapien oft scheitern, weil innere Anteile nicht gesehen werden.
Zwischenfazit: Der Weg führt durch den Körper – aber nicht allein
Was alle diese Ansätze verbindet: Sie verstehen Trauma als körperlich-psychische Ganzheit. Nicht als Schwäche. Nicht als Defekt. Sondern als nicht abgeschlossene Schutzreaktion. Die Tür zu Heilung liegt nicht im Zurückschauen – sondern im Wieder-in-Verbindung-Kommen. Mit sich, mit dem Körper, mit anderen.
Doch körperorientierte Therapie ist kein Wundermittel. Sie braucht:
- Sicherheit
- Vertrauen
- Geduld
- einen bewussten Umgang mit Triggern und Grenzen
Und sie braucht eine Gesellschaft, die nicht nur Leistung, sondern auch Verletzlichkeit zulässt.
Wenn das Private politisch wird – die gesellschaftliche Dimension von Trauma
Psychisches Trauma ist kein Nischenthema. Es beeinflusst nicht nur das Leben einzelner Menschen, sondern auch das soziale Klima, unsere Vorstellungen von Macht, Beziehung, Schuld, Verantwortung. Eine traumatisierte Gesellschaft erkennt man nicht an gebrochenen Knochen – sondern an gebrochenem Vertrauen.
Wie sich Trauma gesellschaftlich ausdrückt
Eine Gesellschaft, die Trauma systematisch verdrängt, produziert:
- Leistungsdruck statt Fürsorge
- Kontrolle statt Vertrauen
- Entwertung statt Empathie
- Funktionieren statt Fühlen
Der Körper darf nicht schwach sein. Die Psyche soll „stabil“ bleiben. Wer leidet, wird oft pathologisiert – oder romantisiert. Beides hilft nicht.
Viele Symptome, die wir als „psychische Erkrankung“ etikettieren, sind in Wahrheit Anpassungsleistungen an eine kranke Umwelt. Wenn Nähe gefährlich war, wird Rückzug zur Strategie. Wenn Bedürftigkeit nie erwünscht war, wird Selbstaufopferung zur Norm. Das ist keine Störung. Es ist Überleben.
Reinszenierung in der Politik: Autorität, Schuld, Kontrolle
Auch auf kollektiver Ebene zeigt sich das Prinzip der Reinszenierung. Gesellschaften, die in ihrer Geschichte massive Gewalterfahrungen gemacht haben – Kolonialismus, Krieg, Diktatur –, neigen dazu, unverarbeitete Traumata zu externalisieren. Drei Beispiele:
1. Autoritäre Fantasien:
Wenn Menschen sich in ihrem Alltag machtlos fühlen, suchen sie Halt in klaren Hierarchien. Politische Reinszenierung zeigt sich dann im Wunsch nach „starken Führern“ – und in der Angst vor Komplexität, Ambivalenz, Vielfalt.
2. Schuldabwehr:
Statt kollektiv Verantwortung zu übernehmen, werden Schuld und Scham abgespalten: „Ich war’s nicht. Ich will davon nichts hören.“ Diese Dynamik prägt die deutsche Nachkriegsgesellschaft bis heute – von der NS-Aufarbeitung bis zu aktuellen Debatten über Kolonialismus oder sexualisierte Gewalt in Institutionen.
3. Kontrolle durch Normierung:
Eine traumatisierte Gesellschaft sucht Sicherheit durch Regeln, Kontrolle, Leistungsnormen. Wer nicht „reinpasst“, wird aussortiert oder pathologisiert – statt gefragt: Was brauchst du eigentlich?
Transgenerationale Weitergabe: Das Trauma in den Zellen
Trauma endet nicht mit der Generation, die es erlebt hat. Es hinterlässt Spuren – auch bei den Kindern und Enkeln. Die transgenerationale Weitergabe kann auf drei Ebenen erfolgen:
1. Psychologisch:
Kinder übernehmen implizit die Ängste, Schamgefühle oder Überlebensstrategien der Eltern – ohne zu wissen, woher sie kommen. Typisch sind Sätze wie:
„Ich durfte nie traurig sein.“
„Ich hatte immer das Gefühl, für die Stimmung meiner Mutter verantwortlich zu sein.“
2. Verhalten:
Eltern mit unverarbeitetem Trauma können keine sichere Bindung geben – nicht aus bösem Willen, sondern weil ihr Nervensystem nicht auf Nähe eingestellt ist. So entstehen neue Bindungstraumata – obwohl „objektiv“ nichts Schlimmes passiert.
3. Epigenetisch:
Forschung zeigt, dass extreme Belastungen (z. B. Holocaust, Krieg, Hunger) biologische Spuren im Erbgut hinterlassen können. Das bedeutet: Die nächste Generation trägt eine erhöhte Verwundbarkeit mit – auf Zellebene.
Van der Kolk nennt das den verkörperten Schrecken – Gabor Maté spricht vom vererbten Stress.
Heilung ist möglich – aber nicht allein
Viele Menschen, die sich auf den Weg der Heilung machen, merken schnell: Es geht nicht nur um sie. Individuelle Traumaarbeit kann nicht losgelöst von sozialen Strukturen funktionieren. Wenn das Umfeld weiter beschämt, beschleunigt, ignoriert – kann es kaum gelingen.
Was es braucht:
- Sichere Räume, in denen Emotionen erlaubt sind
- Sprache, die nicht entwertet, sondern verbindet
- Politik, die Fürsorge nicht als Schwäche sieht
- Kultur, die Verletzlichkeit als Teil des Menschseins integriert
Heilung bedeutet nicht: „Alles ist gut.“ Sondern: Ich bin nicht mehr allein mit dem, was war. Und ich darf sein, wie ich bin.
Und was heißt „Heilung“ überhaupt?
Heilung ist kein Ziel, kein Zustand. Sie ist ein Prozess. Und oft kein linearer.
Heilung heißt:
- dass der Körper wieder atmen darf
- dass Beziehungen nicht mehr als Bedrohung erlebt werden
- dass Nähe möglich ist, ohne sich selbst zu verlieren
- dass man Nein sagen kann – ohne Schuldgefühle
- dass man Ja sagen kann – ohne Angst
Heilung ist nicht das Vergessen. Es ist das Erinnern – ohne erneut zu zerbrechen.
Und jetzt? Was wir tun können – und warum es nicht zu spät ist
Trauma verändert Leben. Still, heimlich, systematisch. Es formt unser Selbstbild, unsere Beziehungen, unsere Weltwahrnehmung. Doch: Trauma ist kein endgültiges Urteil. Es ist eine Wunde – und jede Wunde kann, unter bestimmten Bedingungen, heilen. Nicht durch Vergessen. Sondern durch Integration.
Was jede und jeder tun kann
1. Aufhören, sich selbst zu pathologisieren.
Wenn du unter Ängsten leidest, dich in Beziehungen zurückziehst, extreme Reaktionen zeigst – frag dich nicht zuerst: Was stimmt nicht mit mir? Frag: Was ist mir passiert?
2. Lernen, den Körper wieder zu spüren.
Trauma trennt uns vom eigenen Empfinden. Heilung beginnt oft mit scheinbar simplen Dingen: Spüren, wo du sitzt. Wie du atmest. Ob du gerade frierst. Oder zitterst.
Diese körperlichen Rückmeldungen sind keine Störung. Sie sind Kommunikation.
3. Beziehungen anders gestalten.
Traumatische Muster zeigen sich besonders stark in engen Beziehungen. Wer das erkennt, kann beginnen, sich nicht mehr reflexhaft zu verteidigen – sondern sich langsam mitzuteilen. In Mikro-Schritten. In sicherem Kontakt.
4. Hilfe annehmen – professionell, nicht performativ.
Therapie ist kein Zeichen von Schwäche. Sondern von Verantwortung. EMDR, SE, IFS und andere Methoden bieten Werkzeuge, um aus alten Mustern auszusteigen. Nicht sofort. Aber nachhaltig.
Was wir gesellschaftlich ändern müssen
1. Trauma sichtbar machen – ohne Drama.
Trauma darf kein Tabu bleiben. Aber es darf auch nicht zur Metapher verkommen. Nicht jede Überforderung ist ein Trauma – und nicht jedes Trauma braucht Pathos. Was wir brauchen, ist eine Sprache der Würde und Differenzierung.
2. Bildungssysteme trauma-sensibel gestalten.
Lehrerinnen, Sozialarbeiter, Ärztinnen – sie alle begegnen täglich traumatisierten Menschen. Und oft haben sie selbst Traumafolgen. Es braucht Fortbildungen, Räume der Reflexion und mehr institutionelle Sicherheit.
3. Politische Räume schaffen, die nicht retraumatisieren.
Diskurse über Migration, Rassismus, Gewalt, Geschlecht – sie alle berühren kollektive Traumata. Wer sie führt, ohne traumasensibel zu sein, verschärft Spaltung. Der Ton macht nicht nur die Musik – er bestimmt, wer überhaupt zuhört.
4. Reparative Gerechtigkeit anerkennen.
Ob es um Kolonialverbrechen, die Missbrauchsskandale in Kirchen, Zwangsarbeit oder sexualisierte Gewalt geht: Es braucht Aufarbeitung, nicht Abwehr. Die Wahrheit macht nicht frei – aber das Leugnen macht krank.
Ein neues Bild von Trauma
Vielleicht geht es bei Trauma gar nicht primär um Zerstörung – sondern um Trennung. Vom Selbst, vom Körper, von der Welt. Und vielleicht heißt Heilung nicht: „Zurück zur Normalität“, sondern: Zurück zu mir.
Bessel van der Kolk schreibt:
„Traumatisierte Menschen brauchen nicht nur professionelle Hilfe, sondern auch neue Erfahrungen von Sicherheit, Verbindung und Kontrolle über ihr Leben.“
Das kann kein System alleine leisten. Aber wir alle können Teil davon sein.
Was wir nie vergessen sollten
Trauma zeigt nicht, wie schwach jemand war. Sondern wie stark er oder sie sein musste.
Nicht jede Verletzung ist heilbar. Aber jede Verletzung darf gewürdigt werden.
Heilung ist kein Ziel. Sie ist eine Richtung.
Hast du dich in diesem Text wiedererkannt? Spürst du, dass du oder jemand in deinem Umfeld betroffen sein könnte? Oder arbeitest du selbst mit traumatisierten Menschen? Dann teile deine Gedanken – öffentlich oder im Stillen.
Denn genau das ist der erste Schritt: Nicht mehr schweigen. Nicht mehr alleine tragen. Nicht mehr funktionieren müssen, wenn der Körper längst ruft.
Lass uns Trauma nicht individualisieren – sondern kollektiv verstehen.
Schreib auf den Social Media Plattformen. Diskutiere mit. Und vor allem: Sei sanft mit dir.
Quelle: MEEON #18
Text: Trauma: Gefangen im eigenen Haus
Foto: MEEON