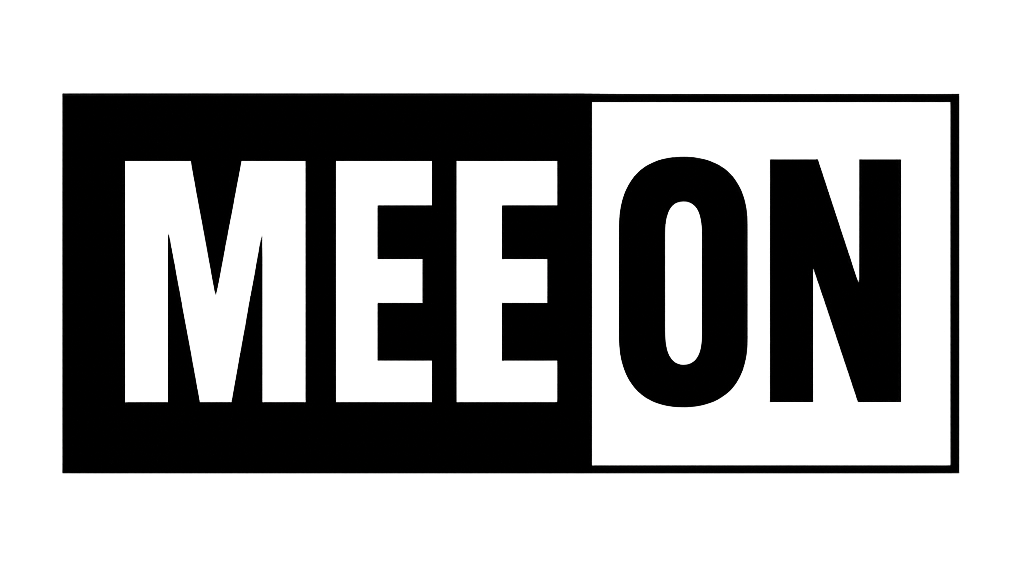Psychosomatik ist kein Mythos. Dein Körper spricht – in Verspannungen, Erschöpfung, Schmerz. Nur: Hörst du ihm zu?
Manche Menschen merken nicht, dass sie krank sind, weil sie nie gelernt haben, gesund zu sein. Sie stehen auf, arbeiten, funktionieren – und überhören dabei die Signale, die ihr Körper längst aussendet. Rückenschmerzen, die kein Arzt erklären kann. Atemnot ohne organischen Befund. Schlafprobleme, Magenkrämpfe, ein Ziehen im Nacken, das einfach nicht verschwindet. All das kann Ausdruck von etwas Tieferem sein: einem Körper, der das Unausgesprochene trägt.
Funktionieren schützt – aber es ersetzt kein Leben
Wer früh gelernt hat, stark zu sein, hat oft keine Sprache für Schwäche. Wer in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem Gefühle keinen Platz hatten, entwickelt Strategien, die auf den ersten Blick wie Stärke aussehen: Pflichtbewusstsein, Leistungsbereitschaft, Kontrolle. Aber unter dieser Oberfläche liegen oft alte Spannungen, die sich nicht einfach abschütteln lassen. Der Körper merkt sich, was der Kopf verdrängt.
Psychosomatik – also das Zusammenspiel zwischen Seele und Körper – beginnt dort, wo emotionale Belastung sich körperlich ausdrückt. Nicht, weil man sich etwas „einbildet“, sondern weil der Körper ein eigenes Gedächtnis hat. Eines, das sich nicht in Gedanken, sondern in Muskelspannung, Hautreaktionen und Nervosität äußert. Das ist keine Schwäche. Das ist Biologie.
Was Trauma mit deinem Nervensystem macht
Trauma bedeutet nicht immer ein großes, dramatisches Ereignis. Es kann auch das stille, schleichende Gefühl sein, nie wirklich sicher gewesen zu sein. Wenn ein Kind Nähe sucht und Abweisung erfährt. Wenn Angst entsteht, aber niemand da ist, der sie aufhängt. Solche Erfahrungen prägen das Nervensystem – und damit den ganzen Körper.
Ein hilfreiches Modell, um das zu verstehen, ist die sogenannte Polyvagal-Theorie. Sie beschreibt, wie unser Körper in Stresssituationen reagiert – mit Kampf, Flucht oder Erstarrung – und wie schwer es ist, wieder in einen Zustand echter Ruhe zu kommen. Wenn der Körper permanent in Alarmbereitschaft bleibt, wirkt sich das auf das Immunsystem, die Verdauung, die Atmung und das Schmerzempfinden aus. Nicht weil du schwach bist. Sondern weil dein System gelernt hat, ständig auf der Hut zu sein.
Wenn Reden nicht reicht
Nicht alle Erfahrungen lassen sich in Worte fassen. Manchmal braucht es andere Wege, um sich selbst wieder zu spüren. Körperorientierte Therapieformen wie Somatic Experiencing, EMDR oder IFS setzen genau dort an. Sie versuchen nicht, alles rational zu erklären, sondern schaffen Räume, in denen der Körper mitreden darf.
Somatic Experiencing etwa hilft, Körpersignale wahrzunehmen und Spannungen sanft zu regulieren. EMDR arbeitet mit gezielten Augenbewegungen oder Tönen, um belastende Erinnerungen zu verarbeiten, ohne sie zu überfordern. IFS – das Innere Familiensystem – geht davon aus, dass in uns verschiedene Persönlichkeitsanteile wirken: ein verletztes Kind, ein innerer Antreiber, ein kritischer Beobachter. Diese Teile dürfen sichtbar werden – und sich neu sortieren.
Heilung beginnt nicht mit dem richtigen Satz. Sondern mit dem Moment, in dem man aufhört, gegen sich selbst zu kämpfen.
Der Körper hört nie auf zu erinnern
Vielleicht hast du gelernt, still zu sein. Vielleicht hast du gelernt, keine Bedürfnisse zu haben. Vielleicht hältst du dich selbst für belastbar, weil du nie gelernt hast, dass man Hilfe verdient. Aber dein Körper weiß es besser. Er rebelliert nicht, weil er gegen dich arbeitet. Er rebelliert, weil er dich retten will. Und weil er der Einzige ist, der geblieben ist, wenn alles andere still wurde.
Heilung ist kein Ziel, sondern ein Weg zurück zum Spüren. Zum echten Atem, zur inneren Wärme, zur Frage: Was brauche ich – jetzt, in diesem Moment? Und was darf gehen?
Quelle: MEEON #61
Text: Dein Körper erinnert sich – auch wenn du’s nicht tust
Bilder: MEEON
Video: MEEON