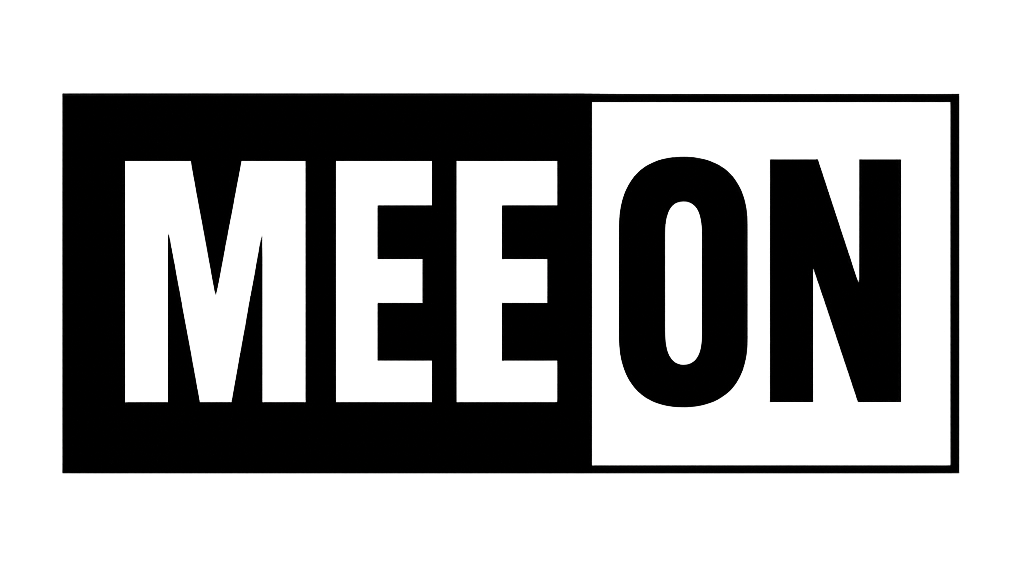Was klingt wie Selfcare-Geflüster, ist in Wahrheit ein hochkomplexer, psychodynamischer Vorgang: bei sich bleiben. Kein Retreat, kein Mantra, sondern eine tägliche Herausforderung – besonders für Menschen, deren innere Landkarte lange von außen geschrieben wurde.
Die Frühprägung: Warum bei sich bleiben kein Kinderspiel ist
Menschen aus emotional instabilen Familienstrukturen entwickeln oft ein ausgeprägtes Gespür für andere – aber ein schwaches Gespür für sich selbst. Das ist kein Charakterzug, sondern ein Schutzmechanismus. Wenn Nähe unberechenbar war, wird Überanpassung zur Überlebensstrategie.
In der Bindungspsychologie spricht man von Selbstobjektfunktion: Das Kind richtet sich nach den emotionalen Bedürfnissen der Bezugsperson, um deren Wohlwollen zu sichern – und verliert darüber den Kontakt zu den eigenen inneren Zuständen. Die Folge: Erwachsene, die perfekt funktionieren, aber innerlich oft leer oder überfordert sind.
Nähe ist kein Ziel, sondern ein Risiko
Das Problem beginnt dort, wo andere „Verbindung“ sagen. Für emotional überforderte Menschen bedeutet echte Nähe oft Kontrollverlust. Intimität wird als Bedrohung erlebt – nicht weil sie unerwünscht ist, sondern weil das Nervensystem Alarm schlägt.
Hier greift ein zentrales Konzept aus der Traumatherapie: das Window of Tolerance. Es beschreibt den Bereich, in dem emotionale Reize verarbeitet werden können, ohne in Stressreaktionen wie Erstarrung oder Übererregung abzugleiten. Wer früh belastet wurde, hat oft ein enges „Fenster“. Und ist deshalb schneller drüber – oder drunter.
Was bedeutet dann „bei sich bleiben“?
Es heißt nicht, sich abzugrenzen wie ein Betonklotz. Und es heißt auch nicht, sich zu verkriechen, um nicht getriggert zu werden. Psychologisch gesehen bedeutet bei sich bleiben:
Ich bleibe in Kontakt mit mir, auch wenn um mich herum Erwartungen, Emotionen oder Konflikte toben.
Das klingt leichter, als es ist. Denn unser Nervensystem will uns in Sicherheit bringen – oft reflexhaft. Es weicht aus, es passt sich an, es spielt nett. Oder es geht in den Angriff. Der Kontakt zu uns selbst wird dabei gekappt wie eine überlastete Leitung.
Typische Dynamiken, in denen du dich verlierst
- Übernahme: Du fühlst dich für die Stimmung anderer verantwortlich.
- Selbstverrat: Du sagst Ja, obwohl dein Inneres laut Nein schreit.
- Rückzug mit Schuldgefühl: Du ziehst dich zurück – und denkst sofort, du bist falsch.
- Anpassung bis zur Unsichtbarkeit: Du wirst immer kleiner, damit kein Konflikt entsteht.
Das alles sind Überlebensmuster – keine „Charakterschwächen“. Aber sie kosten dich langfristig die Verbindung zu deinem inneren Kern.
Mini-Story: Bleib bei dir – auch wenn’s knallt
Du sitzt mit Freundinnen am Tisch. Einer sagt etwas, das dich trifft. Früher hättest du geschwiegen, gelächelt, dich innerlich entfernt. Heute bleibst du. Du spürst dein Herz pochen. Deine Stimme zittert. Du sagst trotzdem: „Das hat mich verletzt.“ Kein Drama. Kein Rückzug. Nur du – bei dir.
Warum Selbstregulation wichtiger ist als Selbstoptimierung
Die meisten Selbsthilfe-Tipps zielen auf Verhalten: besser kommunizieren, klarer abgrenzen, achtsamer sein. Doch wer bei sich bleiben will, muss zuerst verstehen, was im Körper passiert.
Das autonome Nervensystem (Sympathikus & Parasympathikus) ist schneller als dein bewusster Verstand. Es entscheidet in Sekundenbruchteilen, ob du in Verbindung bleiben kannst – oder in den Überlebensmodus gehst. Selbstregulation bedeutet: Du erkennst diesen Moment und findest einen Weg, präsent zu bleiben.
Hilfreiche Fragen in solchen Momenten:
- „Ist das gerade wirklich meins?“
- „Was fühle ich körperlich?“
- „Kann ich das einen Moment einfach da sein lassen – ohne sofort zu reagieren?“
Bei sich bleiben ist Beziehung – nicht Abgrenzung
Oft wird das Konzept missverstanden. Bei sich bleiben heißt nicht: bloß keine Nähe zulassen. Es bedeutet, eine innere Linie zu halten – selbst in intensiven Beziehungen. Nur so entsteht echte Verbindung: wenn niemand sich selbst aufgeben muss, damit das Miteinander funktioniert.
Und jetzt?
Vielleicht ist heute kein Tag für große Veränderungen. Vielleicht reicht ein kleiner Moment der Klarheit. Wenn du beim nächsten Gespräch merkst: Ich verliere mich gerade – dann tritt innerlich einen halben Schritt zurück. Nicht aus Kälte. Sondern aus Selbstkontakt.
Du darfst da sein. Mit allem, was du bist. Nicht perfekt. Nur echt.
Wann hast du das letzte Mal gemerkt, dass du nicht bei dir warst – und was hat dir geholfen, zurückzukommen?
Quelle: MEEON #66
Text: Bleib bei dir!
Bilder: MEEON
Video: MEEON